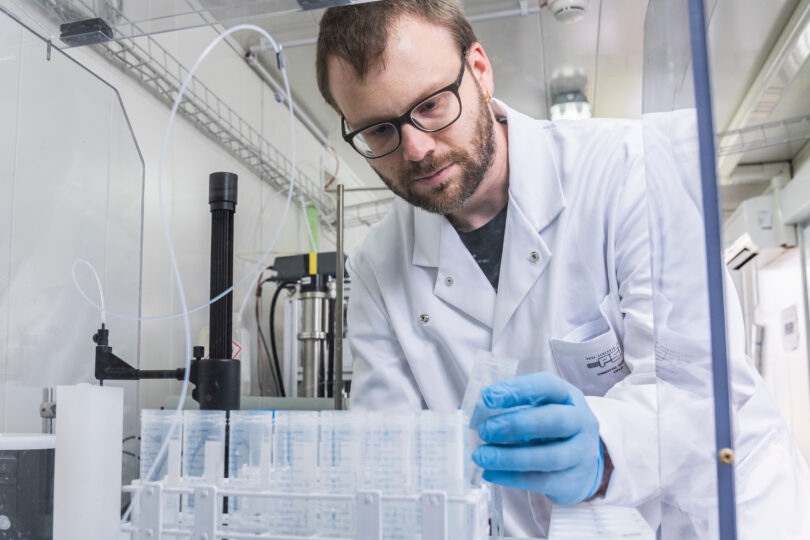Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben gemeinsam mit Kollegen mehrerer europäischer Institutionen untersucht, ob Feinstaub aus bestimmten Quellen besonders gesundheitsschädlich sein kann. Dabei fanden sie Hinweise darauf, dass die Menge des Feinstaubs allein nicht das größte Gesundheitsrisiko darstellt. Vielmehr kann es sein, dass das sogenannte oxidative Potenzial den Feinstaub so schädlich macht. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin Nature.
Feinstaub ist eines der grössten Gesundheitsrisiken, die von Luftverschmutzung ausgehen, und ist, laut Schätzungen mehrerer Studien, jährlich für mehrere Millionen Todesfälle verantwortlich. Damit zählen schlechte Luftqualität und Feinstaub neben Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes und Übergewicht zu den fünf wichtigsten Gesundheitsrisikofaktoren. Was Feinstaub so gefährlich macht, ist allerdings noch nicht genau bekannt. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben nun gemeinsam in einem internationalen Team herausgefunden, dass die Menge an Feinstaub nicht die allein ausschlaggebende Größe darstellt, wenn es um Gesundheitsrisiken geht
Oxidatives Potenzial des Feinstaubs als Gesundheitsrisiko
„Bei der Studie interessierten uns vor allem zwei Punkte“, sagt Kaspar Dällenbach von der Forschungsgruppe Gasphasen- und Aerosolchemie am PSI. „Erstens, welche Quellen in Europa für das sogenannte oxidative Potenzial des Feinstaubs verantwortlich sind, und zweitens, ob das Gesundheitsrisiko des Feinstaubs durch dessen oxidatives Potenzial verursacht wird.“
Als oxidatives Potenzial des Feinstaubs wird die Fähigkeit bezeichnet, Antioxidantien abzubauen, was zur Schädigung von Körperzellen und -gewebe führen kann. In einem ersten Schritt setzten die Forschenden Zellen aus den menschlichen Atemwegen, sogenannte bronchiale Epithelzellen, Feinstaubproben aus und überprüften deren biologische Reaktion. Stehen die Zellen unter Stress, geben sie einen Signalstoff für das Immunsystem ab, der im Körper Entzündungsreaktionen in Gang setzt. Die Forschenden konnten zeigen, dass Feinstaub mit erhöhtem oxidativem Potenzial die Entzündungsreaktion der Zellen verstärkt. Dies legt die Vermutung nahe, dass das oxidative Potenzial bestimmt, wie schädlich der Feinstaub ist. Zwar sei die kausale Verbindung zwischen erhöhtem oxidativen Potenzial und einer Gesundheitsgefährdung noch immer nicht eindeutig nachgewiesen, so Dällenbach. „Die Studie ist aber ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Zusammenhang tatsächlich besteht.“
Eine von der Universität Bern geleitete Partnerstudie zeigte, dass Zellen von Patienten, die unter einer speziellen Vorerkrankung, der sogenannten Cystischen Fibrose, leiden, eine geschwächte Abwehr gegen Feinstaubbelastung aufweisen. Während bei gesunden Zellen ein antioxidativer Abwehrmechanismus das Fortschreiten der Entzündungsreaktionen stoppen konnte, reichte die Abwehrkapazität bei kranken Zellen dazu nicht aus. Das führte zu einer erhöhten Zellsterblichkeit.
Woher kommen der Feinstaub und sein oxidatives Potenzial?
Zusätzlich sammelten die Forschenden Feinstaubproben an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Sie analysierten mithilfe einer am PSI entwickelten Massenspektrometrietechnik die Zusammensetzung des Feinstaubs. Das damit gewonnene chemische Profil jeder Feinstaubprobe lässt auf die Quelle schließen, aus der sie stammt. Außerdem bestimmten Kollegen in Grenoble an den gleichen Proben dessen oxidatives Potenzial, um einen Hinweis auf dessen Gefährlichkeit für die Gesundheit zu erhalten. Mithilfe der detaillierten Analysen und statistischer Methoden bestimmten die Forschenden anschließend das oxidative Potenzial für alle relevanten Emissionsquellen. Auf Grundlage dieser experimentellen Daten berechneten sie in einem Computermodell, an welchen Orten Europas das höchste oxidative Potenzial durch Feinstaub übers Jahr hinweg herrscht, und identifizierten vor allem Ballungsräume wie die französische Hauptstadt Paris oder die Po-Ebene in Norditalien als kritische Regionen.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass das oxidative Potenzial des Feinstaubs und die Feinstaubmenge nicht durch dieselben Quellen bestimmt werden“, resümiert Dällenbach. Der größte Teil des Feinstaubs besteht aus Mineralstaub und sogenannten sekundären anorganischen Aerosolen, wie Ammoniumnitrat und -sulfat. Das oxidative Potenzial des Feinstaubs bestimmen dagegen vor allem sogenannte anthropogene sekundäre organische Aerosole, die hauptsächlich aus Holzfeuerungen stammen, und Metallemissionen aus Bremsen- und Reifenabrieb des Straßenverkehrs. Außerdem fanden die Forschenden heraus, dass die Bevölkerung im urbanen Raum nicht nur einer höheren Feinstaubmenge ausgesetzt ist, sondern dass der Feinstaub in diesen Regionen ein höheres oxidatives Potenzial hat, und deswegen gesundheitsschädlicher als Feinstaub im ländlichen Raum ist. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass alleine die Regulierung der Feinstaubmenge unter Umständen nicht zielführend sein könnte“, sagt Dällenbach. Zudem lasse die Studie der Universität Bern vermuten, dass Bevölkerungsgruppen mit Vorerkrankungen besonders von entsprechenden Massnahmen zur Verringerung der Feinstaubbelastung profitieren könnten.
(Paul Scherrer Institut/Sebastian Jutzi)
Über das PSI
Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt große und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel der Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2100 Mitarbeitende, das damit das größte Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 400 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL.
Weitere Informationen: www.psi.ch/de
Originalpublikation:
Kaspar Rudolf Daellenbach et al.: Sources of particulate matter air pollution and its oxidative potential in Europe. Nature, 18. November 2020
DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2902-8